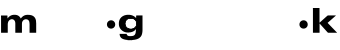Baumkirchen Mitte – Ökologische Vorrangfläche
Leistung
1–5
Bauherr
Baumkirchen Mitte GmbH & Co. KG
Zeitraum
2013-2017
Kategorie
Naturschutzfachliche Planung
Baumkirchen Mitte – Ökologische Vorrangfläche
Auf dem 13 Hektar großen Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes München 4 in Berg am Laim entsteht seit 2013 das Stadtquartier „Baumkirchen Mitte“. Das Areal biete Raum für etwa 1.300 Einwohnerinnen und Einwohner, Arbeitsplätze, Einzelhandel und öffentliche Grünflächen. Eine zum Teil gemeinschaftlich nutzbare Dachlandschaft leistet den Ausgleich zu der dichten Bebauung. Der westliche Teil des Areals leibt als naturnaher Gleispark und Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten erhalten. Mit einem dynamischen Pflegekonzept soll die Standortvielfalt gesichert werden. Ein den Bestand schonendes Erschließungskonzept macht das Biotop öffentlich zugänglich: Lange Stege erstrecken sich über das Gelände, sogenannte Bastionen laden zum Verweilen und Betrachen der Tier- und Pflanzenwelt ein.

Minimaler Eingriff durch Monitoring und Erlebnispfad



Im Bereich der Sukzessionsflächen wird das Totholz belassen, um Insekten und kleinen Wirbeltieren Unterschlupf zu bieten.

„Der neu entstandene Park ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie durch den respektvollen
Umgang mit dem Bestand ein abwechslungsreiches, sich wandelndes Stück Stadtnatur
entstehen konnte, das dem zu beklagenden Artenrückgang eine zeitgemäße Antwort
entgegenstellt.“
– Juryurteil Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis 2021: Auszeichnung in der Kategorie „Landschafts- und Umweltplanung/ Landschaftserleben“